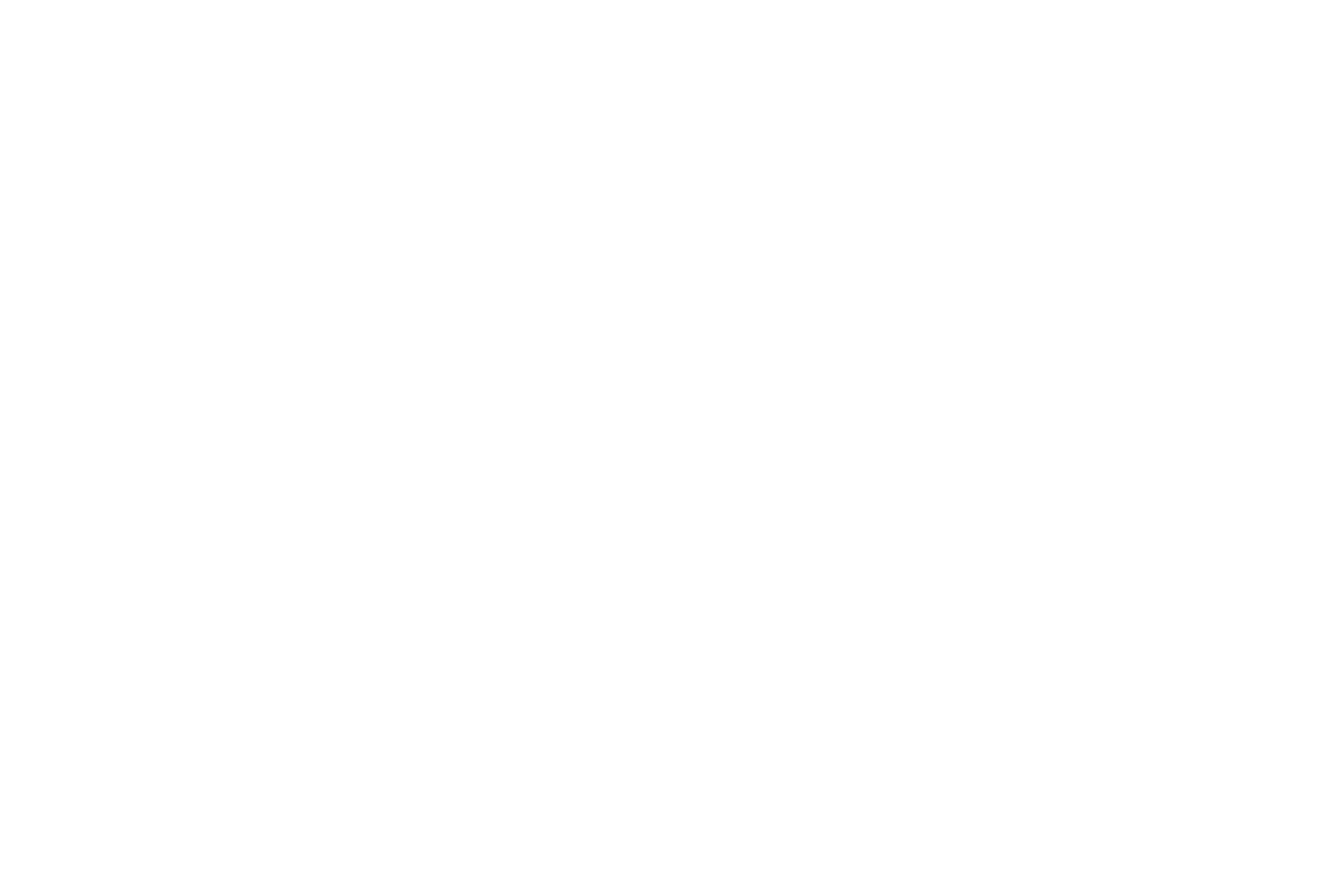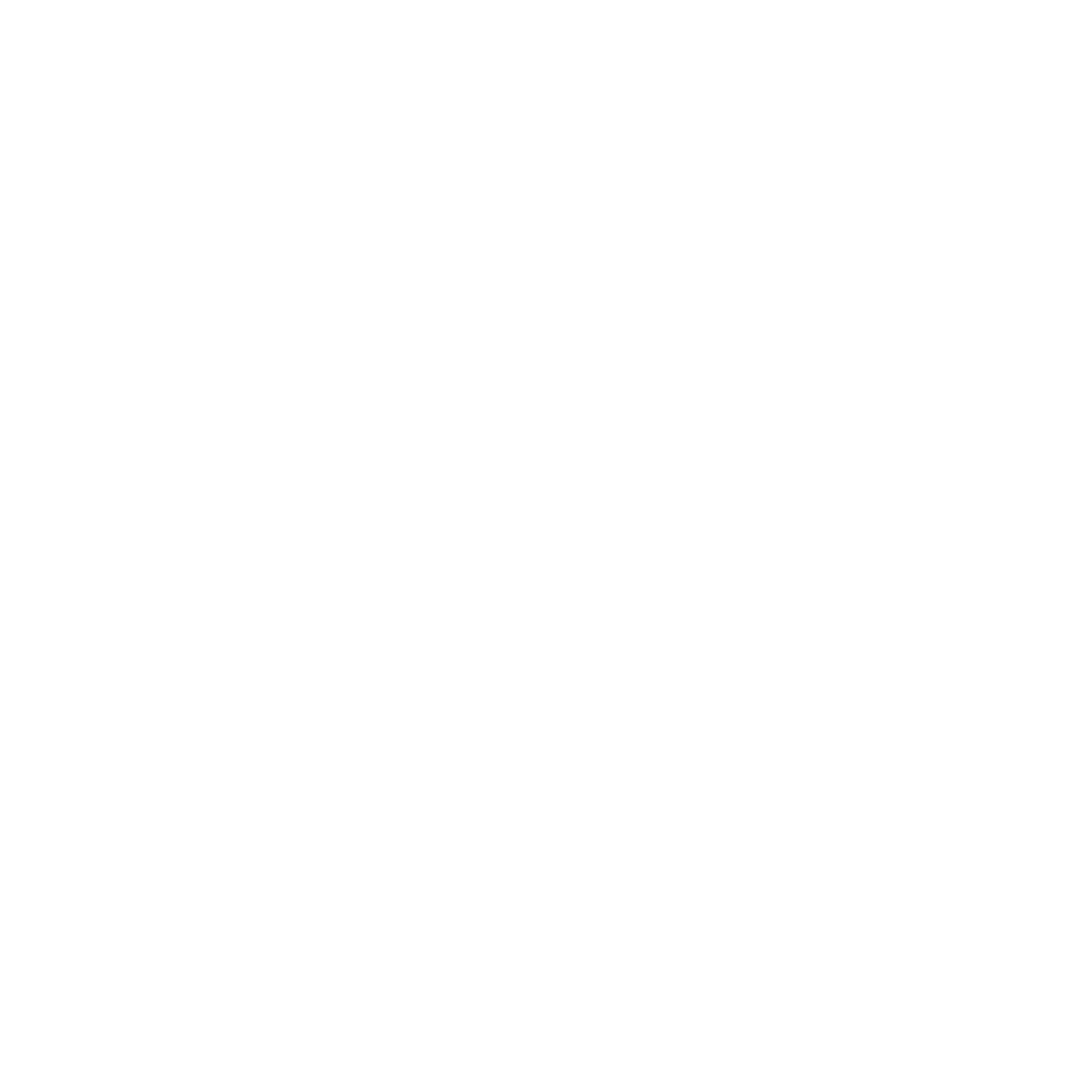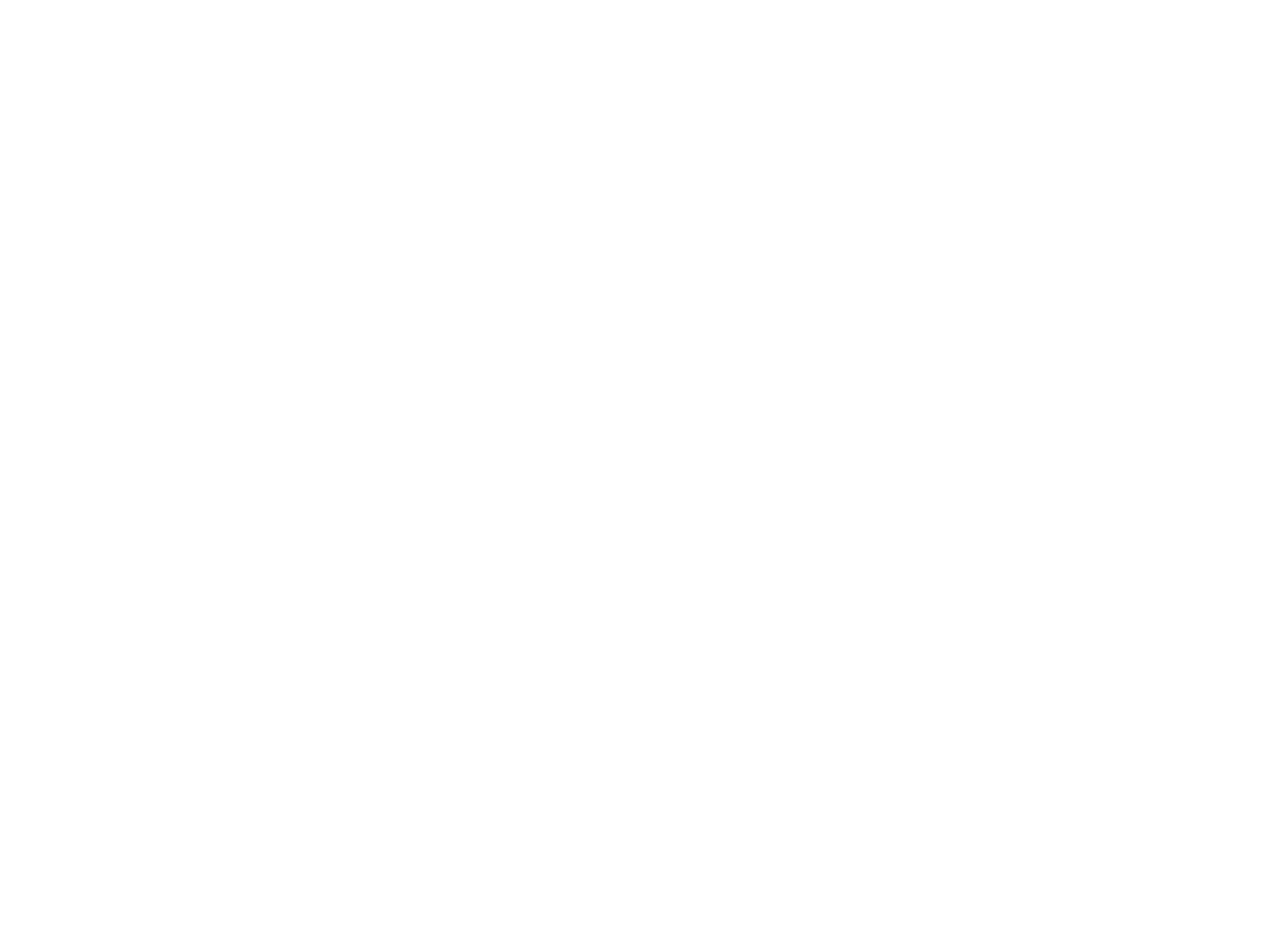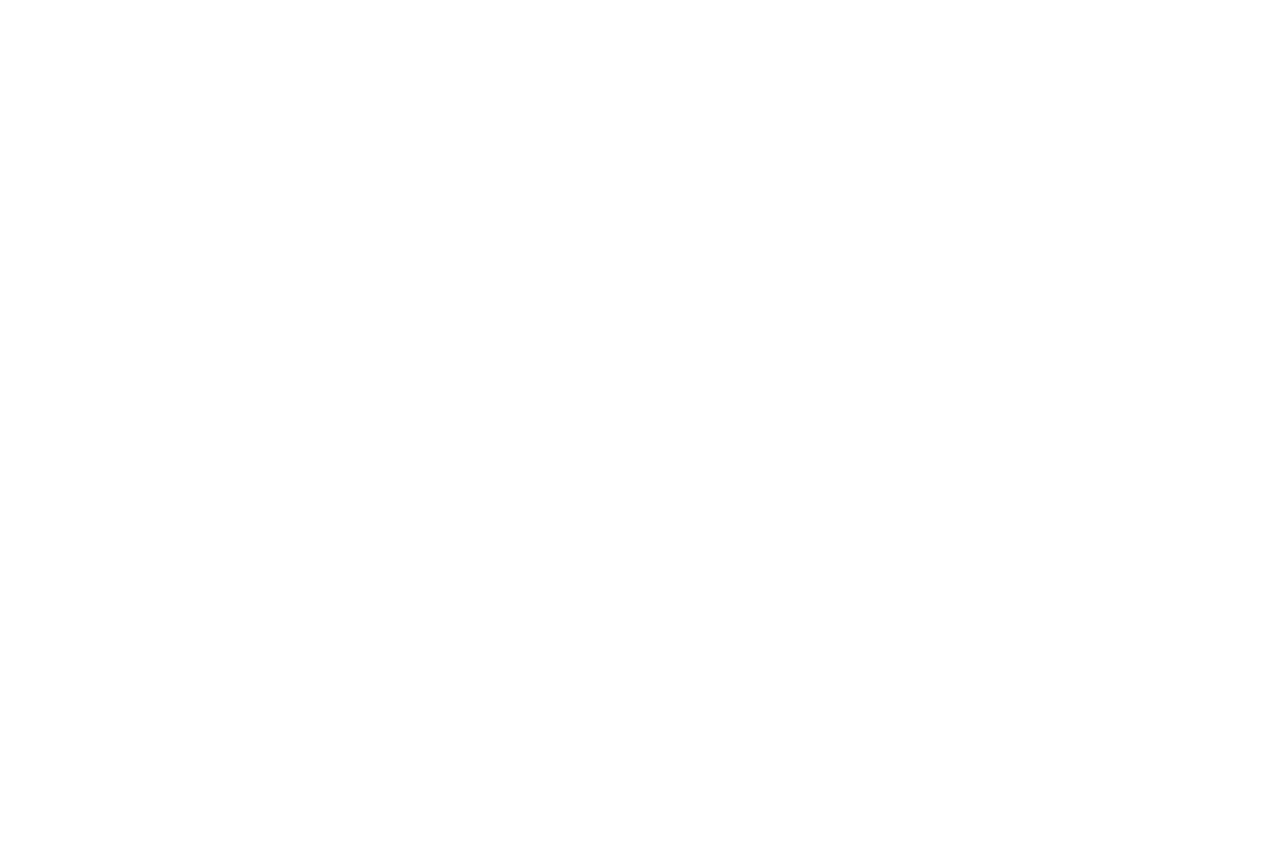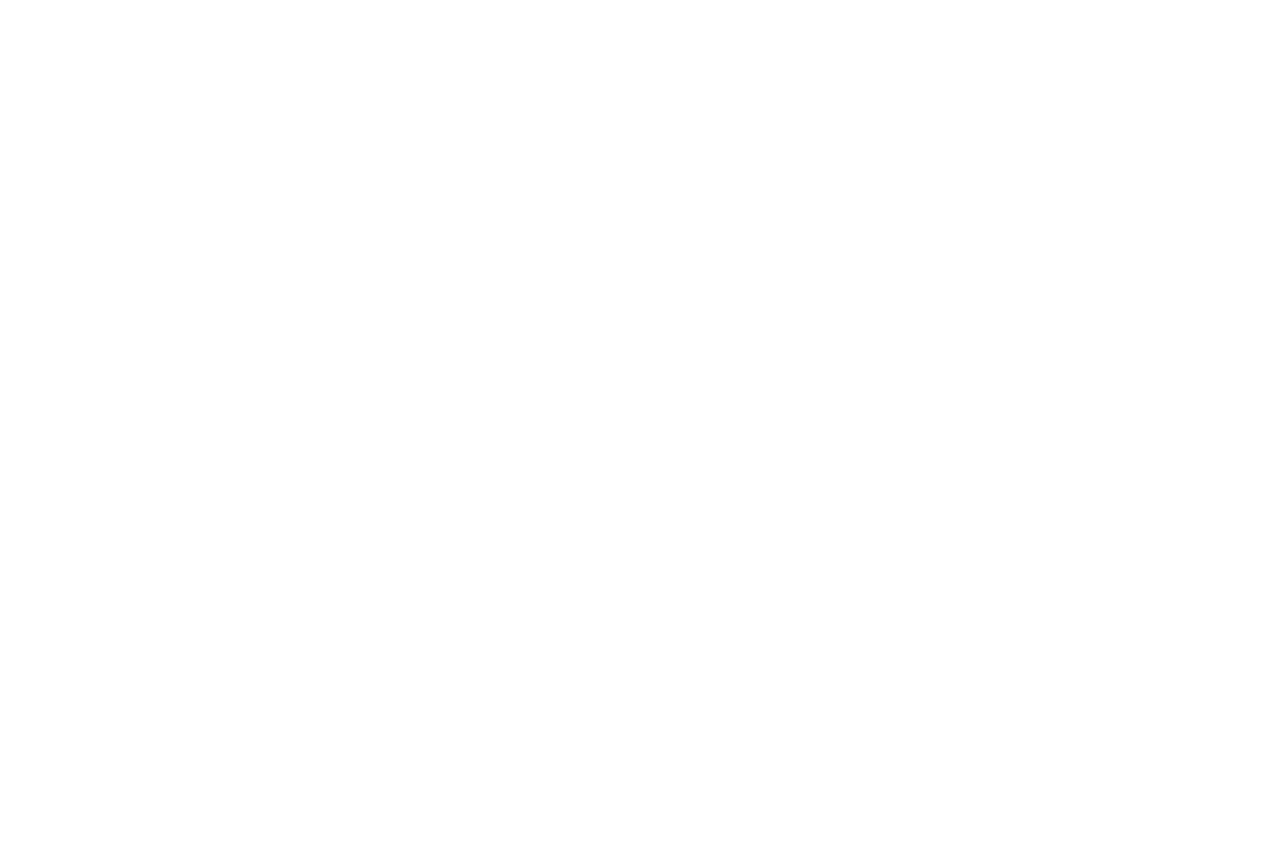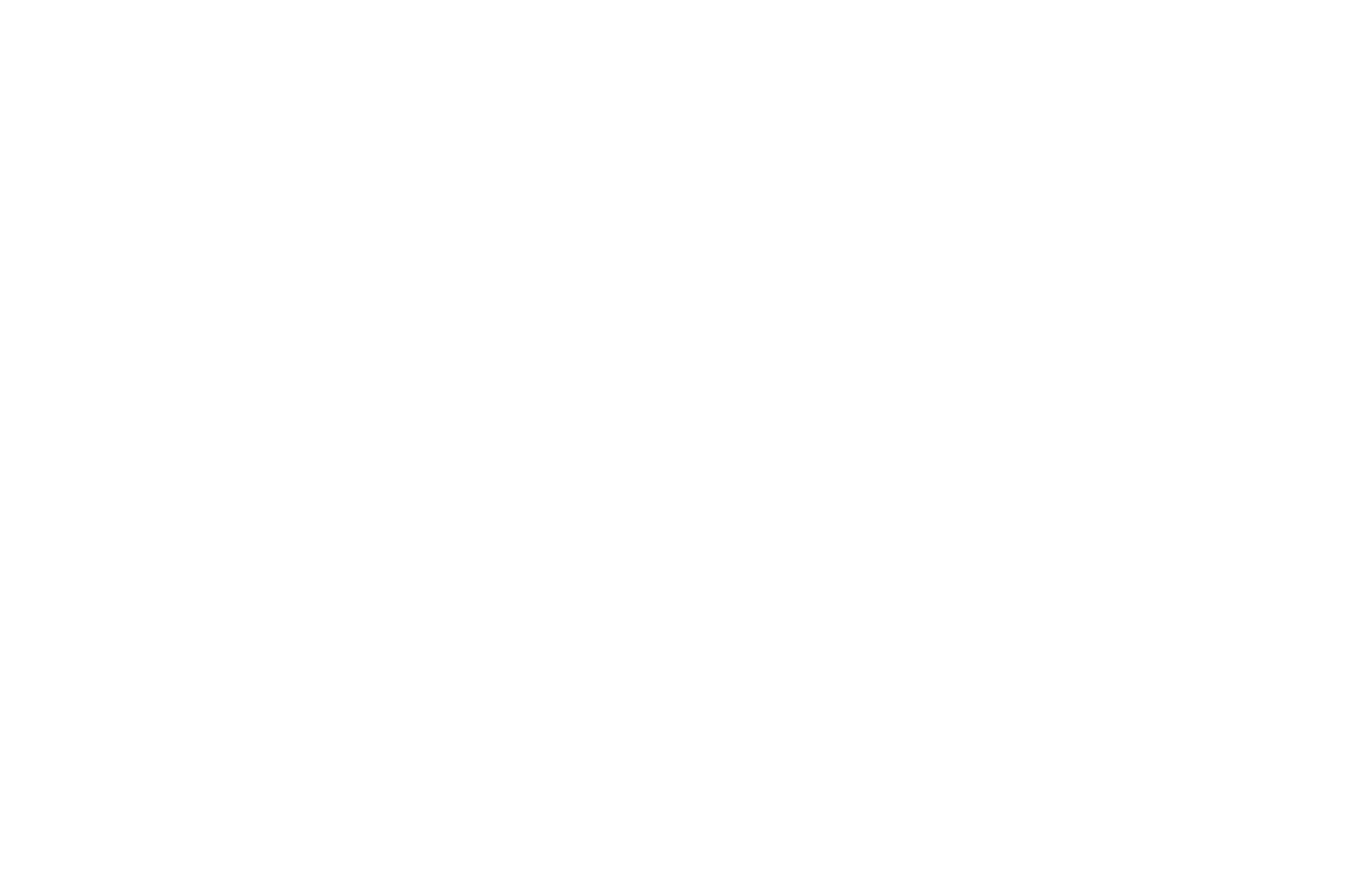Egor Skripkin
Mehrere Sprachen gleichzeitig lernen – Mythos, Realität und funktionierende Strategien
Man kann mehrere Sprachen parallel lernen – wenn man es richtig macht.
„Du wirst am Ende keine einzige Sprache richtig sprechen, wenn du mehrere gleichzeitig lernst.“ – Diesen Satz habe ich unzählige Male gehört, als ich noch in Russland an der Uni war. Damals habe ich Deutsch studiert, parallel hatten wir Englischkurse, und zusätzlich habe ich mit Japanisch angefangen. Meine Kommiliton:innen waren überzeugt davon, dass ich meine Zeit verschwende und mich verzettle. Heute spreche und unterrichte ich Deutsch, Japanisch und Russisch, kommuniziere problemlos auf Englisch, Französisch und Italienisch und lerne aktiv Koreanisch und Arabisch. Habe ich mich also geirrt — oder damals die anderen?
Das Missverständnis steckt schon in der Frage. Mehrsprachigkeit ist kein Zirkustrick, sondern eine Lebensform. Der Psycholinguist François Grosjean (1989) hat das einmal auf eine bis heute zitierte Formel gebracht: „The bilingual is not two monolinguals in one person.“ — „Der/die Zweisprachige ist nicht zwei Einsprachige in einer Person.“ Er weist damit eine Erwartung zurück, die uns heimlich lenkt: dass Sprachen wie identische Gläser nebeneinander stehen müssten, stets randvoll und gleich hoch. Tun sie nicht. Sie bilden ein System mit eigenen Regeln, Schwerpunkten, Domänen. Wer das akzeptiert, lernt plötzlich leichter. Die Linguistin Ellen Bialystok, die seit Jahrzehnten zu Mehrsprachigkeit forscht, schreibt:
„Mehrsprachigkeit ist keine Belastung für das Gehirn, sondern ein Trainingsfeld.“ Bialystok, E. (2001)
In diesem Artikel zeige ich dir, wie paralleles Sprachenlernen funktioniert, warum viele Fehler beim Einstieg passieren und wie du Interferenz vermeidest, Motivation aufrechterhältst und jede Sprache strukturiert in deinen Alltag integrieren kannst.
1. Unterschiedliche Sprachniveaus vermeiden Interferenz
Ein großer Fehler ist, zwei Sprachen auf demselben Niveau gleichzeitig zu beginnen. Wenn du beispielsweise mit zwei A1-Sprachen startest, prallen Grammatik und Vokabeln wie zwei rohe Eier aufeinander – das zerfließt im Kopf.
In meinem Fall war Deutsch bereits auf B2, Englisch auf B1, als ich mit Japanisch bei Null anfing. Genau das hat meinen Einstieg erleichtert, weil sich die Sprachen nicht in die Quere kamen. Die Forschung bestätigt das: Studien zeigen, dass neue Sprachen stabiler verankert werden, wenn bereits eine gefestigte Fremdsprache vorhanden ist.
In meinem Fall war Deutsch bereits auf B2, Englisch auf B1, als ich mit Japanisch bei Null anfing. Genau das hat meinen Einstieg erleichtert, weil sich die Sprachen nicht in die Quere kamen. Die Forschung bestätigt das: Studien zeigen, dass neue Sprachen stabiler verankert werden, wenn bereits eine gefestigte Fremdsprache vorhanden ist.
Starte eine neue Sprache erst dann, wenn eine andere schon „steht“. A2/B1 ist ein guter Zeitpunkt, um eine A1-Sprache dazu zu nehmen.
2. Nicht zwei verwandte Sprachen auf dem gleichen Niveau starten
Deutsch und Englisch, Französisch und Italienisch, Spanisch und Portugiesisch – diese Kombinationen bringen Vorteile, aber auch Probleme. Am Anfang helfen Ähnlichkeiten bei Grammatik und Wortschatz. Aber dann kommt das sogenannte „Code-Mixing“ (Clahsen & Meisel): Man übernimmt Strukturen und Aussprache unbewusst aus der jeweils anderen Sprache.
Bei mir war das extrem: Als ich Englisch lernte, habe ich unbewusst mit deutscher Satzmelodie und Artikulation gesprochen und englische Wörter nach deutscher Grammatik gebaut.
Was funktioniert besser?
Deutsch und Englisch, Französisch und Italienisch, Spanisch und Portugiesisch – diese Kombinationen bringen Vorteile, aber auch Probleme. Am Anfang helfen Ähnlichkeiten bei Grammatik und Wortschatz. Aber dann kommt das sogenannte „Code-Mixing“ (Clahsen & Meisel): Man übernimmt Strukturen und Aussprache unbewusst aus der jeweils anderen Sprache.
Bei mir war das extrem: Als ich Englisch lernte, habe ich unbewusst mit deutscher Satzmelodie und Artikulation gesprochen und englische Wörter nach deutscher Grammatik gebaut.
Was funktioniert besser?
- Zwei verschiedene Sprachfamilien (z.B. Deutsch + Japanisch, Französisch + Koreanisch)
- Verwandte Sprachen nur bei deutlichem Niveauunterschied (z.B. Französisch B2 + Italienisch A1)
3. Themen intelligent trennen
Was viele unterschätzen: Nicht nur Sprachen können sich gegenseitig beeinflussen, sondern auch die Inhalte, mit denen man sie füttert. Wenn du in zwei Sprachen gleichzeitig denselben Wortschatz lernst – etwa „Essen“, „Familie“ oder „Alltag“ – konkurrieren die Begriffe um denselben mentalen Speicherplatz. Ich habe schnell gemerkt, dass mein Kopf klarer bleibt, wenn jede Sprache ein eigenes thematisches Feld bekommt. Lernte ich auf Italienisch Lebensmittel, widmete ich mich im Französischen der Wohnung oder der Freizeit. Allein dieser Abstand sorgte dafür, dass die Vokabeln sich nicht wie zwei identische Kleidungsstücke in derselben Schublade verheddern. Das Gleiche gilt für Grammatik: Wer zur gleichen Zeit in mehreren Sprachen ähnliche Strukturen übt – zum Beispiel Zeiten, Artikel oder Konditionalsätze –, zwingt das Gehirn in denselben Tunnel. Wenn die Inhalte sich unterscheiden, bleiben die Bahnen stabiler und das Erinnern wird leichter, weil sich jede Sprache über ihren thematischen Kontext verankert.
4. Zeitliche und räumliche Trennung!
Das Gehirn liebt Ordnung und ist keine Sprach-Waschmaschine. Wenn du mehrere Sprachen parallel lernst, verteile sie am besten auf verschiedene Tageszeiten oder Wochentage:
Das Gehirn liebt Ordnung und ist keine Sprach-Waschmaschine. Wenn du mehrere Sprachen parallel lernst, verteile sie am besten auf verschiedene Tageszeiten oder Wochentage:
- Montag = Koreanisch
- Dienstag = Italienisch
- Mittwoch = Französisch
- oder morgens Japanisch, abends Englisch
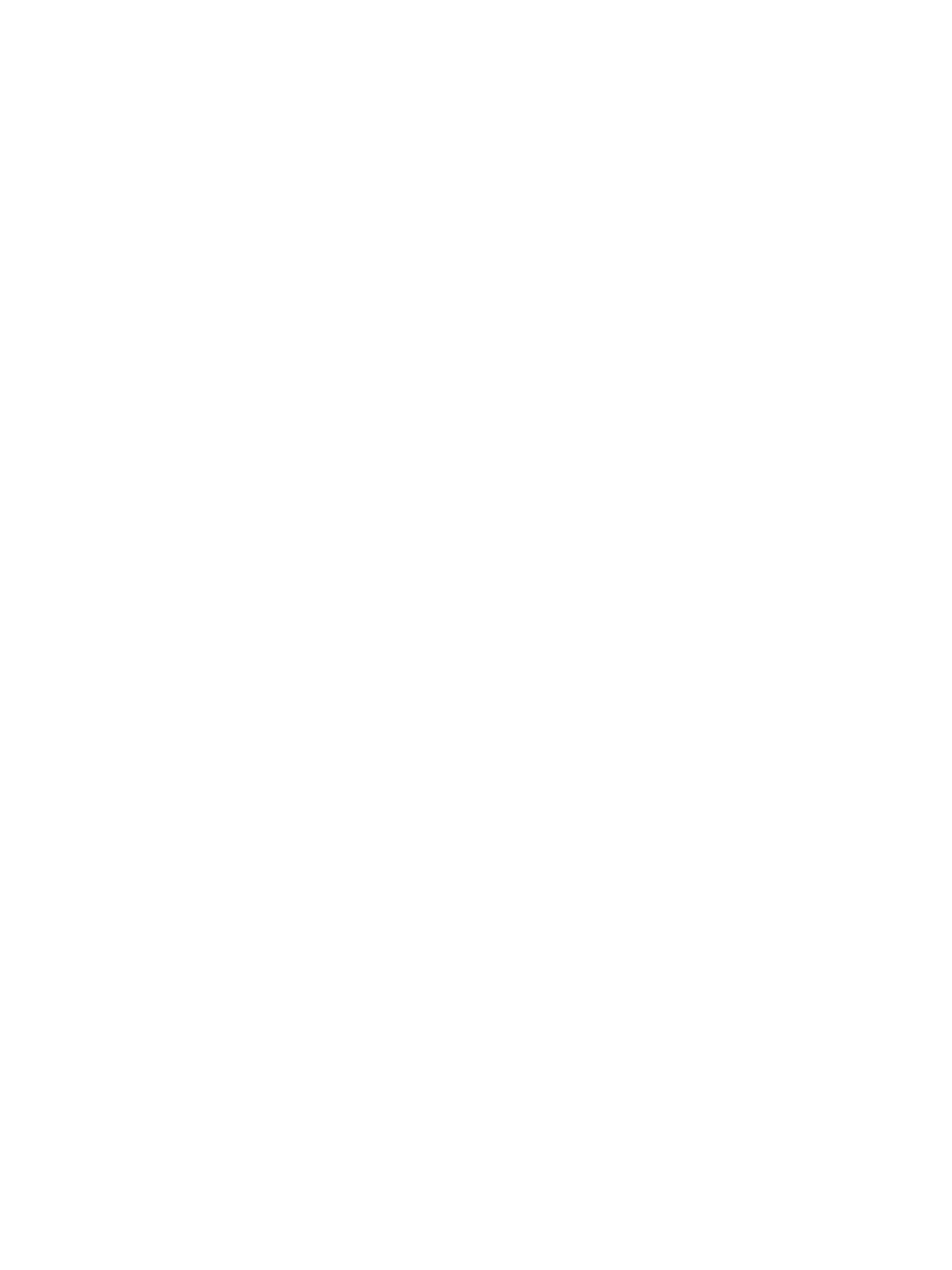
5. Lerne eine Sprache durch eine andere
Das ist ein Geheimtipp, den kaum jemand nutzt: Eine neue Sprache durch eine bereits bekannte Fremdsprache lernen. Zum Beispiel Italienisch mit einem Französisch-Lehrbuch. Dadurch kommst du automatisch in den sogenannten „Kontrastivmodus“, den Grosjean beschreibt: Dein Gehirn vergleicht aktiv statt zu vermischen.
Ich habe Italienisch mit französischen Lehrmaterialien gelernt – und plötzlich wurde klar, was ähnlich, anders oder irreführend ist. Lernbücher für Muttersprachler:innen einer ähnlichen Sprache liefern dir die Vergleiche gleich mit.
Ich habe Italienisch mit französischen Lehrmaterialien gelernt – und plötzlich wurde klar, was ähnlich, anders oder irreführend ist. Lernbücher für Muttersprachler:innen einer ähnlichen Sprache liefern dir die Vergleiche gleich mit.
6. Nicht zwei schwache Sprachen am selben Tag pushen
Besonders heikel wird es, wenn zwei Sprachen noch keine stabile Basis haben. Zwei Anfängerlevel gleichzeitig am selben Tag zu trainieren ist, als würde man versuchen, zwei unausgeschlafene Kleinkinder gleichzeitig zu tragen – man verliert den Halt und die Nerven. Ich habe irgendwann aufgehört, Koreanisch A2 und Arabisch A1 am selben Tag zu lernen. Stattdessen kombinierte ich eine schwache Sprache mit einer gefestigten, etwa morgens Arabisch auf A1 und später Italienisch auf B2. Diese Mischung entlastet das Gedächtnis weil die Art, wie man lernt, sich je nach Niveau unterscheidet.
In einer starken Sprache lese ich vielleicht einen Artikel, markiere Wendungen, schreibe eigene Sätze oder fasse Inhalte zusammen. In einer ganz neuen Sprache dagegen sitze ich über dem Alphabet, über einfachen Strukturen oder Themen wie „meine Familie“, und arbeite langsamer, fast wie beim Legen von Fundamentsteinen.
Das heißt: Nicht nur die Kombination der Sprachen entscheidet, sondern auch die Art, wie man sie lernt – eine zum Aufbauen, die andere zum Stabilisieren.
Besonders heikel wird es, wenn zwei Sprachen noch keine stabile Basis haben. Zwei Anfängerlevel gleichzeitig am selben Tag zu trainieren ist, als würde man versuchen, zwei unausgeschlafene Kleinkinder gleichzeitig zu tragen – man verliert den Halt und die Nerven. Ich habe irgendwann aufgehört, Koreanisch A2 und Arabisch A1 am selben Tag zu lernen. Stattdessen kombinierte ich eine schwache Sprache mit einer gefestigten, etwa morgens Arabisch auf A1 und später Italienisch auf B2. Diese Mischung entlastet das Gedächtnis weil die Art, wie man lernt, sich je nach Niveau unterscheidet.
In einer starken Sprache lese ich vielleicht einen Artikel, markiere Wendungen, schreibe eigene Sätze oder fasse Inhalte zusammen. In einer ganz neuen Sprache dagegen sitze ich über dem Alphabet, über einfachen Strukturen oder Themen wie „meine Familie“, und arbeite langsamer, fast wie beim Legen von Fundamentsteinen.
Das heißt: Nicht nur die Kombination der Sprachen entscheidet, sondern auch die Art, wie man sie lernt – eine zum Aufbauen, die andere zum Stabilisieren.
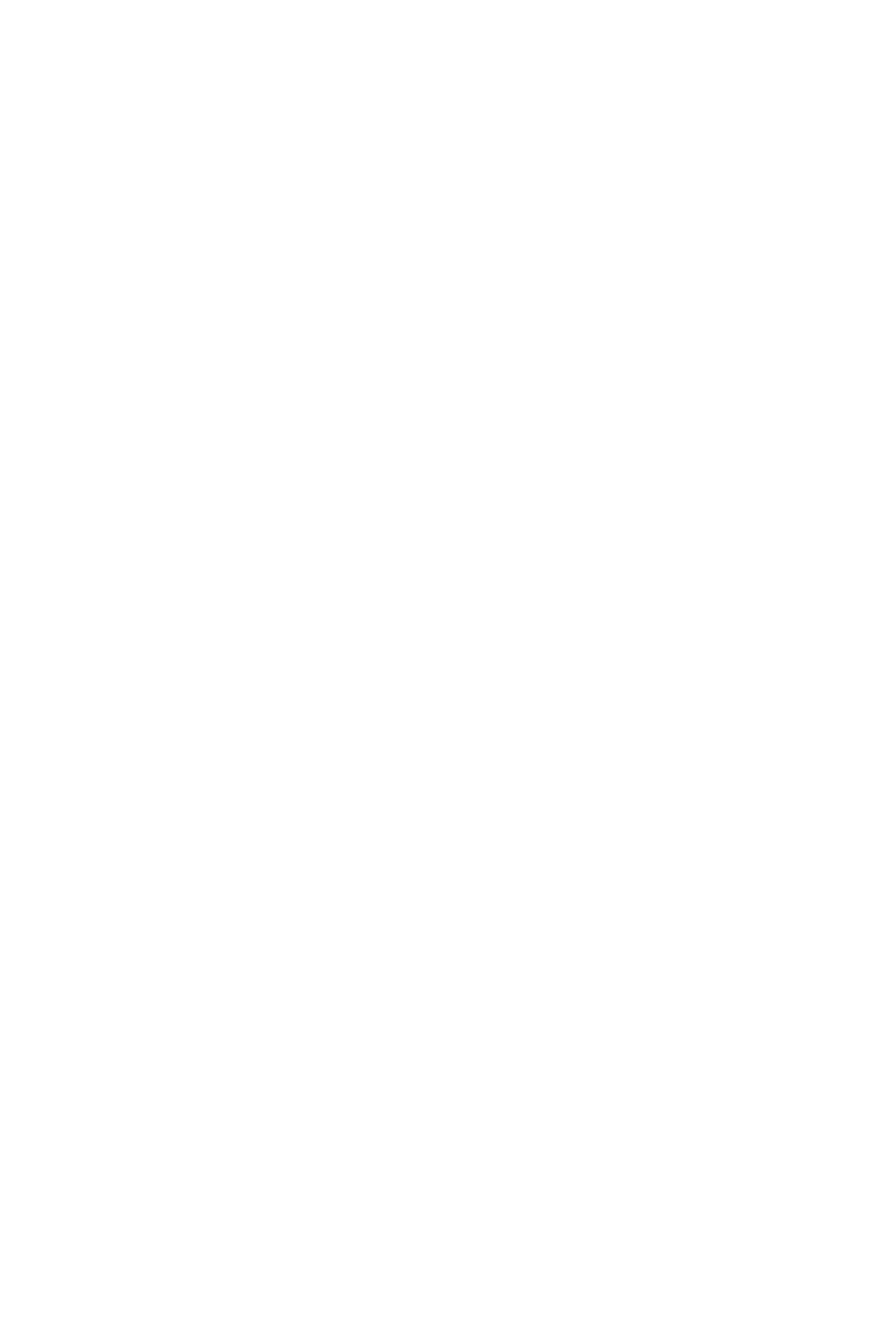
morgens A1, abends C1
Wenn du zwei Anfänger-Sprachen am selben Tag lernst, überforderst du dein Arbeitsgedächtnis. Nimm lieber eine starke Sprache als Gegengewicht.
7. Unterschiedliche Kanäle benutzen
Auch der Zugang zu einer Sprache entscheidet darüber, wie sauber sie im Kopf bleibt. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang Japanisch fast nur gelesen und geschrieben, während Französisch über Serien und Hörbücher zu mir kam und Italienisch eher durchs Sprechen. Allein dadurch, dass ich nicht alle Sprachen in denselben Lernmodus steckte, haben sie sich automatisch voneinander getrennt. Das Gehirn speichert Erlebnisse kontextuell: Eine Sprache, die mit Musik, Videos oder Tandem verbunden ist, landet in einer anderen mentalen Schublade als eine Sprache, die man über Grammatikhefte oder Chats lernt.
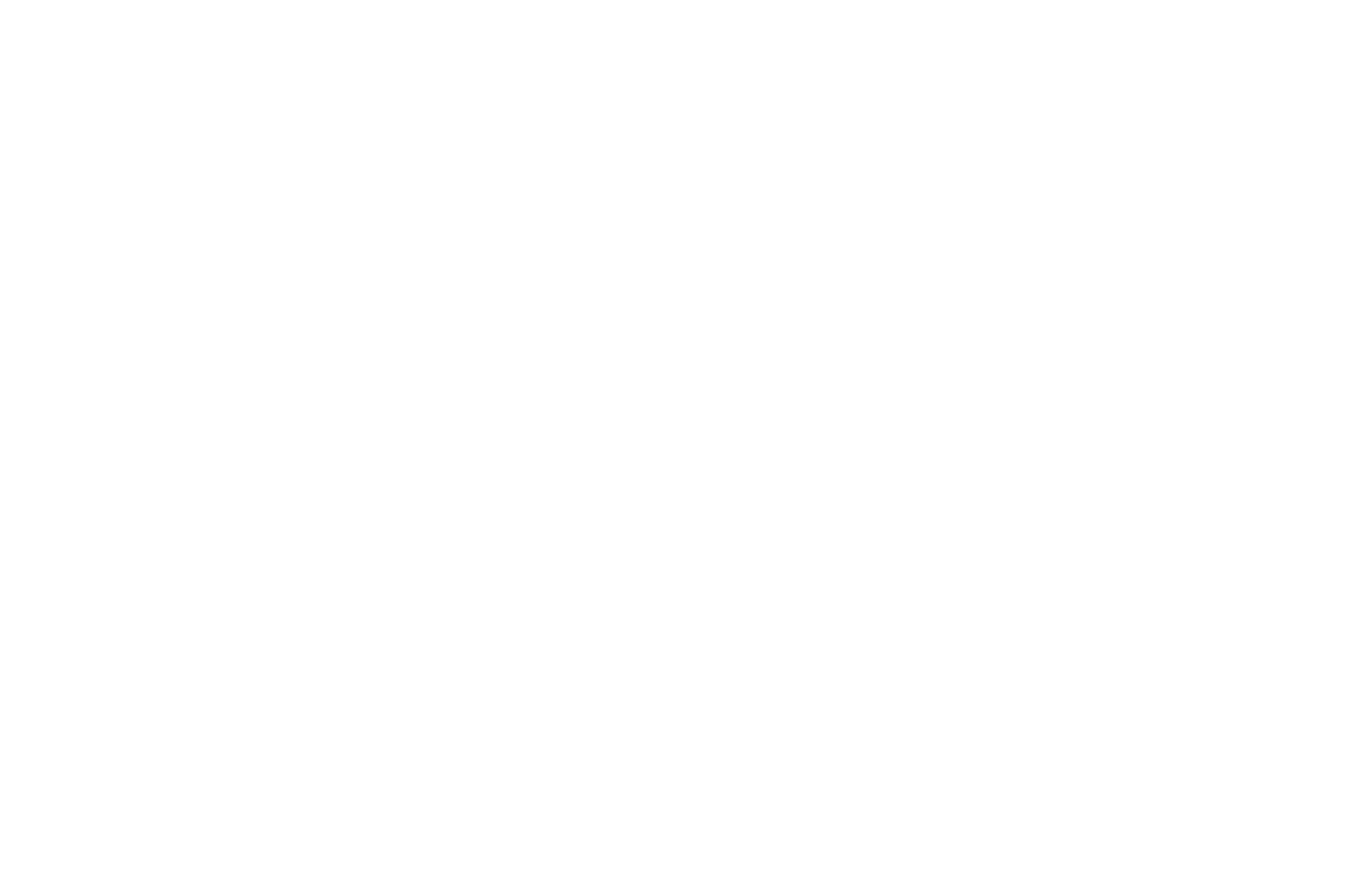
Kein Tag ohne Kontakt zur Sprache – auch wenn es nur passiv ist.
8. Kleine tägliche Kontakte sind wichtiger als große Lernblöcke
Entscheidend war für mich die Erkenntnis, dass Intensität überschätzt und Regelmäßigkeit unterschätzt werden. Zehn oder fünfzehn Minuten pro Tag reichen oft, um eine Sprache lebendig zu halten. Ein Video, ein kurzer Dialog, ein Lied, ein Absatz in einem Buch – das Gehirn braucht nicht immer Lernmarathon, sondern konstante Berührung. Der sogenannte „Spacing Effect“, den unter anderem Nicholas Cepeda untersucht hat, zeigt, dass verteiltes Lernen deutlich effizienter ist als geballte Lerneinheiten mit langen Pausen. Man hält eine Sprache nicht durch Perfektion am Leben, sondern durch kleine, regelmäßige Impulse.
Entscheidend war für mich die Erkenntnis, dass Intensität überschätzt und Regelmäßigkeit unterschätzt werden. Zehn oder fünfzehn Minuten pro Tag reichen oft, um eine Sprache lebendig zu halten. Ein Video, ein kurzer Dialog, ein Lied, ein Absatz in einem Buch – das Gehirn braucht nicht immer Lernmarathon, sondern konstante Berührung. Der sogenannte „Spacing Effect“, den unter anderem Nicholas Cepeda untersucht hat, zeigt, dass verteiltes Lernen deutlich effizienter ist als geballte Lerneinheiten mit langen Pausen. Man hält eine Sprache nicht durch Perfektion am Leben, sondern durch kleine, regelmäßige Impulse.
9. Rotation statt Gleichzeitigkeit
„Sprache-des-Monats-System“
Die größte Entlastung entstand, als ich aufhörte zu glauben, alle Sprachen müssten jederzeit gleich gepflegt werden. Stattdessen begann ich zu rotieren.
Mal stand Koreanisch im Fokus, während Italienisch und Französisch im Hintergrund mitliefen, dann rückte Japanisch nach vorn und Französisch bekam eine Pause.
Keine Sprache verschwindet dadurch – sie ruht, bis sie wieder drankommt. Diese Art von Rotationsprinzip verhindert Überforderung und erzeugt langfristige Stabilität.
Mehrsprachigkeit ist weniger ein Stundenplan als ein Kreislauf: Man muss nicht alles gleichzeitig gießen, damit es wächst.
10. Jede Sprache braucht einen Platz im echten Leben
Wenn du eine Sprache nicht irgendwo benutzt, wird sie von anderen verdrängt.
Du brauchst einen sogenannten „Bridge Point“:
Du brauchst einen sogenannten „Bridge Point“:
- eine Serie,
- eine Community,
- ein Hobby,
- ein kulturelles Thema,
- eine reale Person, mit der du sprichst,
- ein Ziel (Reise, Buch, Film, Zertifikat).
11. Motivation = Treibstoff für jede Sprache
Der nächste Punkt, den viele unterschätzen, ist Motivation. Motivation ist kein Gefühl, sondern ein Ort, an dem eine Sprache im Leben verankert ist.
Wenn sie keinen Platz in der Realität hat, kollabiert sie unter der Konkurrenz der anderen.
Ich habe mir einmal alle Bände von Harry Potter in verschiedenen Sprachen gekauft: Italienisch, Französisch, Japanisch, Englisch, Arabisch, Koreanisch, Deutsch und Russisch. Nicht um sie alle sofort zu lesen, sondern damit mein Gehirn ein Bild hat: „Dafür lerne ich.“Das funktioniert besser als jedes „Ich muss Vokabeln pauken“.
Bei Koreanisch hat mich das Buch „Kim Jiyoung, geboren 1982“, so gepackt, dass ich plötzlich wissen wollte, wie Menschen dort denken und sprechen. Seitdem lerne ich intensiver, ohne es zu planen.
Motivation ist in der Forschung längst beschrieben – Deci und Ryan sprechen von Autonomie, Kompetenzerleben und Sinn. Wenn du einen Film sehen, ein Buch lesen oder mit Menschen sprechen willst, entsteht automatisch ein innerer Antrieb. Wenn du nur „lernen sollst“, stirbt der Impuls schnell ab.
Jede Sprache braucht einen Haken im echten Leben, sonst gibt sie den Platz frei für eine andere.
Wenn sie keinen Platz in der Realität hat, kollabiert sie unter der Konkurrenz der anderen.
Ich habe mir einmal alle Bände von Harry Potter in verschiedenen Sprachen gekauft: Italienisch, Französisch, Japanisch, Englisch, Arabisch, Koreanisch, Deutsch und Russisch. Nicht um sie alle sofort zu lesen, sondern damit mein Gehirn ein Bild hat: „Dafür lerne ich.“Das funktioniert besser als jedes „Ich muss Vokabeln pauken“.
Bei Koreanisch hat mich das Buch „Kim Jiyoung, geboren 1982“, so gepackt, dass ich plötzlich wissen wollte, wie Menschen dort denken und sprechen. Seitdem lerne ich intensiver, ohne es zu planen.
Motivation ist in der Forschung längst beschrieben – Deci und Ryan sprechen von Autonomie, Kompetenzerleben und Sinn. Wenn du einen Film sehen, ein Buch lesen oder mit Menschen sprechen willst, entsteht automatisch ein innerer Antrieb. Wenn du nur „lernen sollst“, stirbt der Impuls schnell ab.
Jede Sprache braucht einen Haken im echten Leben, sonst gibt sie den Platz frei für eine andere.
| Fazit Als ich an der Uni saß und mir anhören musste, dass man „am Ende keine einzige Sprache richtig spricht“, wenn man mehrere gleichzeitig lernt, klang das damals wie ein Gesetz. Heute weiß ich: Das Problem war nie die Anzahl der Sprachen – es war die Vorstellung, dass man sie alle auf die gleiche Weise, im selben Moment und unter denselben Bedingungen lernen müsse. Wer Sprachen trennt, statt sie zu verknoten, erlebt keine Verwirrung, sondern Ordnung. Wer Unterschiede zulässt – im Niveau, im Thema, im Tempo, im Zugang – schafft kein Chaos, sondern Struktur. Und genau diese Struktur ist es, die das Lernen leichter macht, nicht schwerer. Viele scheitern nicht daran, dass sie zu viel wollen, sondern daran, dass sie aus Angst gar nicht erst anfangen. Dabei ist Mehrsprachigkeit kein Risiko, sondern ein Werkzeug. Es ist wie beim Kochen: Du kannst verschiedene Gerichte parallel zubereiten, solange sie nicht alle in denselben Topf geworfen werden. Eine Sprache darf gerade köcheln, eine andere braucht noch Vorbereitung, eine dritte wird vielleicht nur abgeschmeckt oder warmgehalten. Chaos entsteht nicht durch Vielfalt, sondern durch das Gefühl, alles müsse gleichzeitig auf einer Flamme passieren. Wenn dich mehrere Sprachen faszinieren, dann tu es. Lern sie – parallel, abwechselnd oder nacheinander, aber mit Verstand und nicht mit schlechtem Gewissen. Lass dich nicht davon abhalten von Menschen, die glauben, dein Kopf hätte nur Platz für eine Sprache. Dein Gehirn ist keine Einzimmerwohnung, sondern ein Haus mit mehreren Räumen. Du musst nur entscheiden, in welchem du gerade bist – und dort das Licht anschalten. Und wenn du jemanden brauchst, der dich durch die Räume führt, dir den Schlüssel zur Sprache reicht oder dich einfach daran erinnert, wo der Lichtschalter sitzt – sag Bescheid. Egor Skripkin |
Follow Egor on Instagram
Quellen
- Grosjean, François (1989): Neurolinguists, beware! The bilingual is not two monolinguals in one person. Brain and Language, 36(1), 3–15.
- Grosjean, François (2013): Bilingual and Monolingual Language Modes. In: The Psycholinguistics of Bilingualism. Wiley-Blackwell.
- Bialystok, Ellen (2001): Bilingualism in Development: Language, Literacy, and Cognition. Cambridge University Press.
- Odlin, Terence (1989): Language Transfer: Cross-Linguistic Influence in Language Learning. Cambridge University Press.
- Jarvis, Scott & Pavlenko, Aneta (2008): Crosslinguistic Influence in Language and Cognition. Routledge.
- Cepeda, Nicholas J. et al. (2006): Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. Psychological Bulletin, 132(3), 354–380.
- Sobel, H.S., Cepeda, N.J. & Kapler, I.V. (2011): Spacing effects in real-world classroom vocabulary learning. Applied Cognitive Psychology, 25(5), 763–767.
- Ryan, Richard M. & Deci, Edward L. (2000): Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.